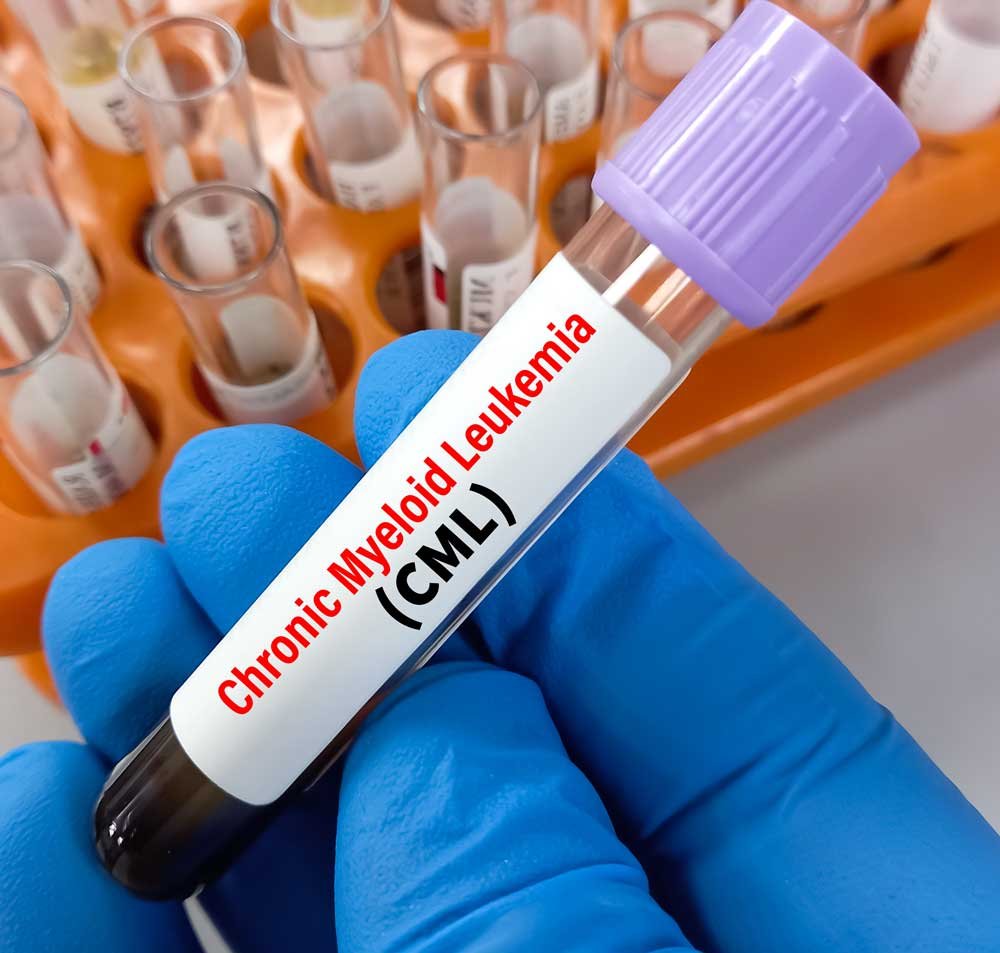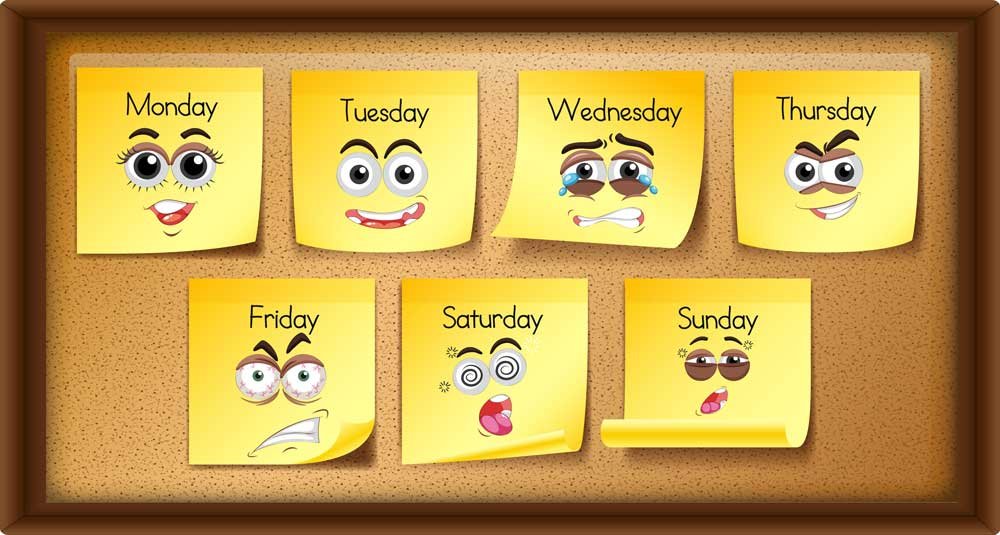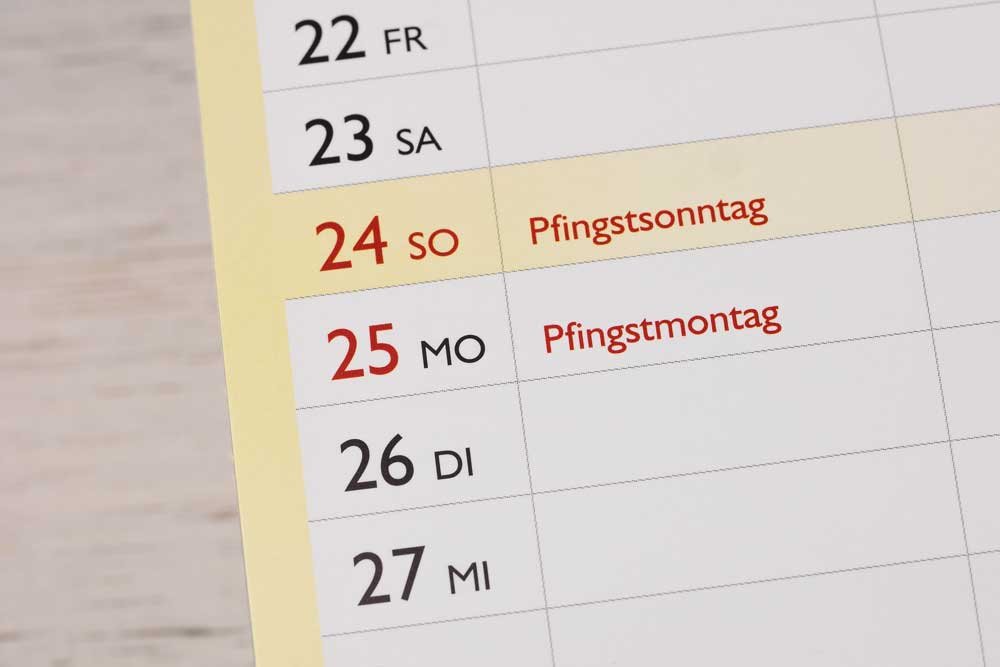Jedes Jahr am 23. September wird der Tag der Bisexualität begangen. Dieser Gedenktag soll auf die Vielfalt sexueller Orientierungen aufmerksam machen. Insbesondere steht dabei die Anerkennung von Menschen im Mittelpunkt, die sich emotional, romantisch oder sexuell zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen.
Die Initiative entstand 1999 durch drei US-Aktivist*innen. Sie wollten damit auf die oft unsichtbaren Erfahrungen bisexueller Personen hinweisen. Statistisch gesehen ist diese Orientierung die drittgrößte Gruppe nach Hetero- und Homosexualität.
Bis heute bleibt der Aktionstag relevant. Viele Menschen erleben weiterhin Diskriminierung oder Vorurteile. Der 23. September bietet Raum für Aufklärung und Solidarität. Alternativ ist die Bezeichnung „Tag der bisexuellen Sichtbarkeit“ geläufig.
Dieser Artikel beleuchtet die historische Entstehung des Datums. Zudem wird die gesellschaftliche Bedeutung näher betrachtet. Leser erhalten einen fundierten Überblick über Hintergründe und aktuelle Entwicklungen.
Schlüsselerkenntnisse
- Der 23. September ist der offizielle Gedenktag für bisexuelle Menschen.
- Bisexualität zählt zu den drei häufigsten sexuellen Orientierungen weltweit.
- Drei US-Aktivist*innen initiierten den Tag im Jahr 1999.
- Diskriminierung und Unsichtbarkeit bleiben zentrale Themen.
- Der Tag fördert Sichtbarkeit und gesellschaftliche Akzeptanz.
Was ist der Tag der Bisexualität?
Seit 1999 setzt dieser Aktionstag ein Zeichen für Sichtbarkeit. Er richtet sich speziell an Personen, die sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen. International ist er als „Celebrate Bisexuality Day“ bekannt.
Der 23. September vereint zwei Ziele: Feiern und Aufklären. Anders als der CSD konzentriert er sich auf spezifische Themen der Bi+-Community. Dazu gehören Diskriminierung oder das Infragestellen der Identität.
Bisexualität gilt als eigenständige sexuelle Orientierung, nicht als Phase. Dies zu betonen, ist ein Kernanliegen des Tages. 2013 verstärkte Jürgen Domian dies durch einen öffentlichen Coming-out-Aufruf.
Aktivitäten reichen von Social-Media-Kampagnen bis zu Podiumsdiskussionen. Jährlich wechselnde Schwerpunkte behandeln aktuelle Herausforderungen. So wird die Vielfalt der Erfahrungen bisexueller Menschen sichtbar gemacht.
Die Geschichte des Tags der Bisexualität
1999 wurde während der ILGA-Weltkonferenz in Chicago eine Initiative leben gerufen, die bis heute nachhallt. Drei US-Aktivist*innen erkannten die Notwendigkeit, bisexuelle Erfahrungen sichtbar zu machen.

Ursprünge und Gründung im Jahr 1999
Wendy Curry, Michael Page und Gigi Raven Wilbur gelten als Gründungspersonen. Sie wählten bewusst den Namen „Celebrate Bisexuality Day“, um Freude und Stolz auszudrücken. Die Wahl des Datums – kurz vor dem CSD – sollte Aufmerksamkeit bündeln.
BiNet USA übernahm in den ersten Jahren die Koordination. Die Organisation half, lokale Events in eine globale Bewegung zu verwandeln. 2009 feierte der Tag sein 10-jähriges Jubiläum mit besonderen Kampagnen.
Ziele der Bewegung
Die Gründer*innen wollten wissenschaftliche Anerkennung fördern. Gleichzeitig ging es um Medienpräsenz und Vernetzung. Bisexualität sollte als eigenständige Orientierung neben Hetero- und Homosexualität gelten.
Heute zeigt der Erfolg des Tages: Aus kleinen Anfängen entstand eine internationale Plattform. Diskussionen über Unsichtbarkeit oder Biphobie werden hier geführt.
Bedeutung und Herausforderungen der Bisexualität
Wissenschaftliche Studien belegen die Existenz dieser Orientierung seit Jahrzehnten. Die American Psychological Association (APA) erkannte sie 1998 offiziell an, die WHO bereits 1990. Dennoch kämpfen viele Menschen um Akzeptanz.
Bisexualität als eigenständige sexuelle Orientierung
Bisexualität ist keine Übergangsphase, sondern eine eigenständige sexuelle Identität. Laut RKI identifizieren sich 1–5 % der Bevölkerung so. Aktuelle Diskurse zeigen Überschneidungen mit pansexuellen oder queeren Identitäten.
Eine Studie des BMBF (2017) belegt: Viele erleben doppelte Diskriminierung. Sie fühlen sich weder in hetero- noch homosexuellen Räumen voll akzeptiert. Die Community fordert daher mehr Sensibilisierung.
Biphobie und Unsichtbarkeit
Die EU-Grundrechteagentur dokumentierte 2020 häufige Diskriminierung. Besonders Frauen berichten von Herabwürdigung. Das Deutschlandfunk-Feature (2018) zeigt Fallbeispiele aus dem Gesundheitswesen.
| Diskriminierungsform | Häufigkeit (in %) |
|---|---|
| Infragestellen der Identität | 43 |
| Ausschluss aus queeren Räumen | 28 |
| Arbeitsplatzdiskriminierung | 19 |
Jugendliche brauchen laut Studie „Coming-out… und dann?!“ länger für ihre Selbstfindung. Sichtbarkeit und Aufklärung bleiben zentrale Ziele.
Wie man Bisexualität unterstützen kann
Unterstützung beginnt im Kleinen und wirkt in die Gesellschaft hinein. Jeder kann dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und bisexuelle Menschen sichtbarer zu machen. Die Initiative „Bi Leben NRW“ bietet konkrete Ansätze.

Tipps für mehr Akzeptanz im Alltag
Die NRW-Broschüre empfiehlt: Vermeiden Sie Zuschreibungen wie „Phase“ oder „Unentschlossenheit“. Bisexualität ist eine eigenständige Orientierung. Schulen und Arbeitgeber können durch Workshops sensibilisieren.
Sprache ist entscheidend. Begriffe wie „Biphobie“ sollten aktiv genutzt werden, um Diskriminierung zu benennen. Safe Spaces – ob online oder offline – schaffen Vertrauen.
Die Rolle der Community und Medien
Das Netzwerk Bi+Pride (gegründet 2016) organisiert Flaggenhissungen und Events. Eine Aktivistin betont: „Sichtbarkeit beweist Identität – nicht umgekehrt.“
Medien tragen Verantwortung. Der „Schöner schreiben“-Leitfaden hilft, Klischees zu vermeiden. Serien wie „Sense8“ zeigen positive Beispiele, doch viele Formate reduzieren Leben auf Stereotype.
Fazit
Neue Studien und Events zeigen den Wandel im gesellschaftlichen Diskurs. Seit 1999 hat die Bi+ Community globale Sichtbarkeit erreicht, doch Diskriminierung bleibt eine Herausforderung. Initiativen wie die deutsche Bi+Jugendstudie 2022 liefern wichtige Daten für zielgerichtete Unterstützung.
Medien können durch diverse Darstellungen Vorurteile abbauen. Organisationen wie Bi+Pride schaffen mit Events Safe Spaces. Jeder kann helfen – durch Spenden, Volunteering oder Aufklärung im Alltag.
Die Zukunft bis 2030 verspricht mehr Akzeptanz. Mit kontinuierlicher Arbeit wird die sexuellen Orientierung als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft anerkannt. Der Weg dahin erfordert Engagement und Solidarität.