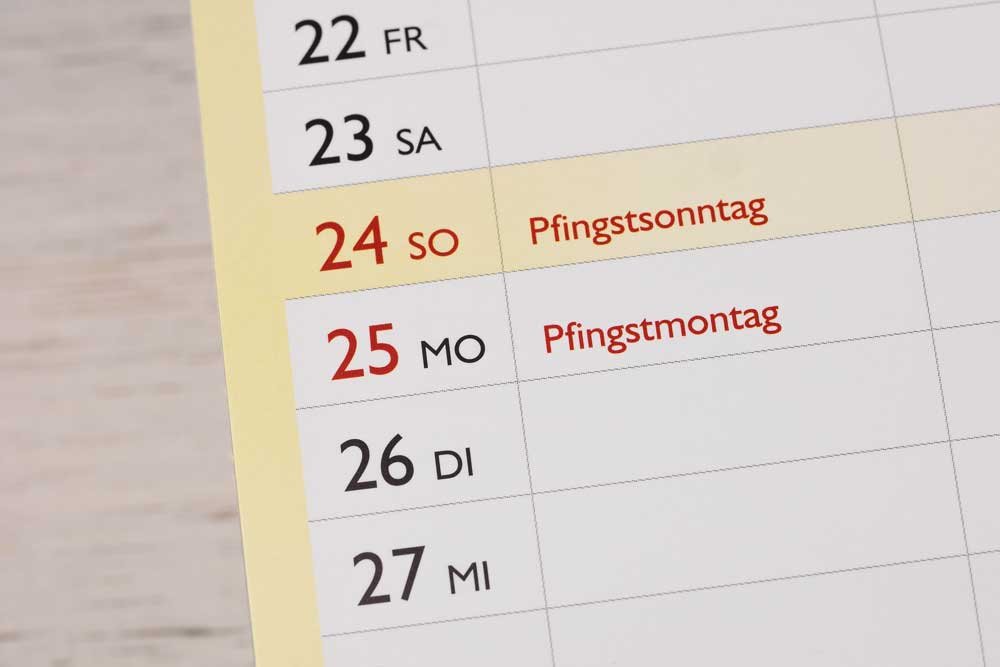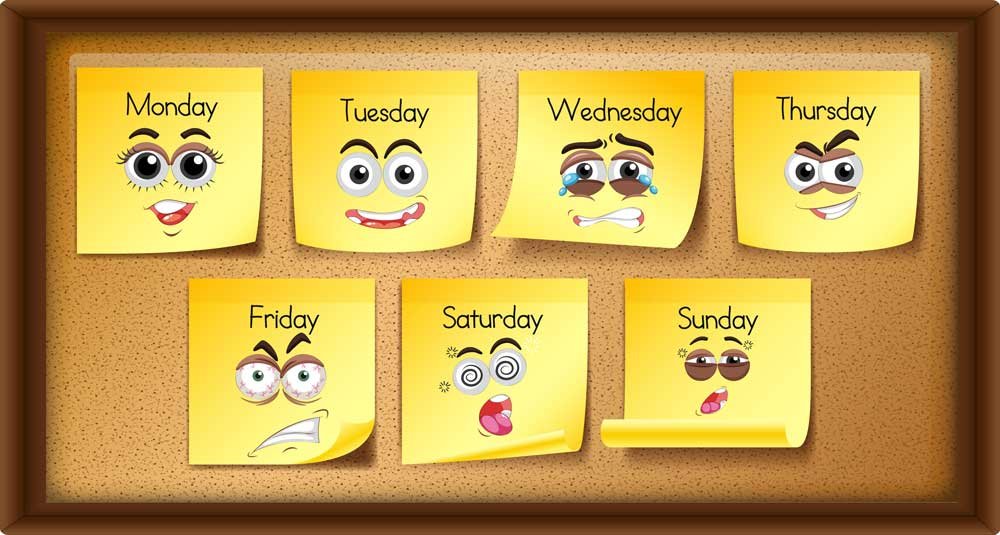Der 3. Oktober ist gesetzlicher Feiertag der Bundesrepublik. Die Bestimmung folgt dem Einigungsvertrag und markiert die Wiederherstellung staatlicher Einheit.
Am 3. Oktober 1990 wurde um 00:00 Uhr erstmals die Flagge der Einheit auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude gehisst. Diese Zeremonie hat bis heute symbolische Bedeutung für Staat und Gesellschaft.
Die jährlichen Feierlichkeiten richtet jeweils das Land mit dem Vorsitz im Bundesrat aus. Das Protokoll Inland koordiniert Absprachen zwischen Bundesorganen und ausrichtendem Land.
Bundesweit beflaggen oberste Bundesbehörden und nachgeordnete Einrichtungen ihre Dienststellen. Bevölkerung und Delegationen werden durch Bürgerfeste und offizielle Akte eingebunden.
Dieser Beitrag bietet kompakte Informationen zu Anlass, Ritualen und staatlicher Praxis und dient als strukturierter Guide für interessierte Menschen.
Weiterführende Fakten sind auch auf der entsprechenden Wikipedia-Seite verfügbar: Tag der Deutschen Einheit.
Wesentliche Erkenntnisse
- 3. Oktober ist gesetzlicher Feiertag gemäß Einigungsvertrag.
- Die Flagge wurde 1990 um 00:00 Uhr auf dem Platz der Republik gehisst.
- Feiern werden vom jeweils federführenden Bundesland organisiert.
- Das Protokoll Inland koordiniert die bundesweite Abstimmung.
- Bürgerfeste binden die Bevölkerung und Delegationen ein.
- Oberste Bundesbehörden führen am Feiertag Beflaggung durch.
Tag der Deutschen Einheit
Dieses Datum steht für die formale Wiederherstellung staatlicher Einheit nach jahrzehntelanger Teilung.
Die Basis bildete die Friedliche Revolution im Herbst 1989. Massenausreisen, Massenproteste und der Machtwechsel in der SED-Führung leiteten den Wandel ein.
Am 18. März 1990 fanden freie Wahlen zur Volkskammer statt. Dieses demokratische Ereignis bereitete den späteren Beitrittsbeschluss vor.
Die Volkskammer entschied am 23. August 1990 gemäß Artikel 23 GG a.F. über den Beitritt zur Bundesrepublik. Der Einigungsvertrag setzte die rechtliche Umsetzung um.
Mit Wirkung zum 3. Oktober 1990 trat die DDR dem Grundgesetz bei. Seit diesem Datum ist der Anlass ein gesetzlicher Feiertag und ein kollektiver Bezugspunkt für Menschen in allen Ländern.
„Die Wiedervereinigung ist das Ergebnis politischer Umbrüche, demokratischer Entscheidungen und gesellschaftlicher Kraftanstrengung.“
- Definition: Nationales Datum für die staatsrechtliche Vereinigung.
- Kontext: Entstehung durch Friedliche Revolution, Proteste und Ausreisen.
- Schlüsseldaten: 18. März 1990 (Wahl), 23. August 1990 (Beitritt), Oktober 1990 (Wirkung).
Von der Friedlichen Revolution zur Wiedervereinigung: Historische Meilensteine
Im Herbst 1989 beschleunigte sich in der DDR eine Welle von Ausreisen und Protesten. Diese Dynamik schwächte das politische Gewicht der SED und führte im Oktober/November 1989 zur Ablösung der Regierung Stoph.
Herbst 1989: Massenausreise und Sturz der Führung
Seit Spätsommer 1989 nahmen Ausreisebewegungen und Massenproteste zu. Menschen forderten Reisefreiheit, Transparenz und politische Reformen.
9. November 1989: Fall der Mauer
Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Dieses Ereignis machte Bewegungsfreiheit und politische Öffnung sichtbar.
18. März 1990: Freie Volkskammerwahl
Die Volkskammerwahl am 18. März 1990 brachte eine demokratisch legitimierte Regierung. Sie ebnete den Weg für den Beschluss zum Beitritt gemäß Artikel 23 GG a.F.
1. Juli bis 3. Oktober 1990: Union und Beitritt
Ab 1. Juli 1990 galt die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Parallel liefen Einigungsvertragsverhandlungen.
Der formale Beitritt erfolgte im Oktober 1990 und vollendete die rechtliche Basis für die schnelle politische Wiedervereinigung.
- Herbst 1989: Druck durch Proteste und Fluchtbewegungen
- 9. November 1989: Fall der Mauer als symbolischer Einschnitt
- 18. März 1990: Freie Wahlen als Legitimationsschritt
- 1. Juli–3. Oktober 1990: Systemintegration und Beitritt
Rechtlicher und internationaler Rahmen der Deutschen Einheit
Rechtlich wurde die Wiedervereinigung durch einen innerstaatlichen Vertrag und ein völkerrechtliches Abkommen abgesichert.
Der Einigungsvertrag regelte, dass die DDR mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitritt. Kapitel 1, Artikel 2 Absatz 2, setzte den 3. Oktober als gesetzlichen Feiertag fest.
Das Abkommen strukturierte Beitritt, Institutionenangleichung und Übergangsregelungen klar. Damit entstanden verbindliche Rechtsgrundlagen für Verwaltung, Rechtspflege und soziale Fragen.
Zwei-plus-Vier-Vertrag: Internationale Zustimmung
Parallel schloss der Zwei-plus-Vier-Vertrag die außenpolitische Seite. In Moskau unterzeichneten die Außenminister am 12. September 1990 die Vereinbarung.
Die USA, die UdSSR, Frankreich und Großbritannien erklärten damit das Ende ihrer spezifischen Rechte und Verantwortlichkeiten für Berlin und ganz Deutschland.
Die Kombination aus Einigungsvertrag und dem völkerrechtlichen Abkommen schuf Rechtssicherheit und internationale Anerkennung. Das stärkte das Vertrauen von Institutionen und vielen Menschen in den Prozess der Wiedervereinigung.
Weiterführende Informationen finden sich in der Deutschen Wiedervereinigung-Darstellung.
Symbole, Rituale und föderale Praxis am 3. Oktober
Die Praxis am Festtag verbindet staatliche Protokolle mit bürgerschaftlicher Teilhabe.
Schwarz-Rot-Gold: Farben von Einigkeit, Recht und Freiheit
Schwarz-Rot-Gold gilt als demokratisches Symbol. Die Verwendung folgt strikten Regeln und wird gegen missbräuchliche Nutzung abgegrenzt.
Beflaggung des Bundes und offizieller Festakt
Am Datum werden oberste Bundesbehörden und ihre Einrichtungen beflaggt. Der Festakt erfolgt in Kooperation von Bundesrat und einem weiteren Verfassungsorgan.
Die Veranstaltung kombiniert offizielle Redebeiträge mit Bürgerfesten und Delegationen. So werden staatliche Abläufe mit öffentlicher Teilnahme verknüpft.
„Die Farben stehen für Einigkeit, Recht und Freiheit.“
Rotierender Gastgeber und 0:00 Uhr am Platz der Republik
Die Ausrichtung wechselt jährlich nach dem Bundesratsvorsitz. Das ermöglicht landesspezifische Akzente und lokale Perspektiven.
Das Hissen der Flagge um 0:00 Uhr am Platz der Republik hat Tradition seit 1990. Dieses Ritual symbolisiert die formale Vollendung der Wiedervereinigung.
| Aspekt | Praxis | Beteiligte |
|---|---|---|
| Farben | Reglementierte Nutzung, Symbolik | Bund, Behörden, Öffentlichkeit |
| Beflaggung | Einheitliche Beflaggung oberer Dienststellen | Bundesbehörden, nachgeordnete Stellen |
| Festakt | Gemeinsame Ausrichtung, Reden, Ehrengäste | Bundesrat, Verfassungsorgan, Länder |
| Beteiligung | Bürgerfeste, Delegationen, lokale Programme | Menschen, Verbände, Kommunen |
Staatliche Protokollstellen koordinieren Planung und Ablauf. Sie sorgen für Abstimmung zwischen Bundesorganen und dem ausrichtenden Land.
Gesellschaftliche Dimension: Vielfalt, Erfahrungen und Debatten
Integration und Migration haben das soziale Gefüge seit dem Jahr der Wiedervereinigung verändert.
Bundespräsident Steinmeier formulierte, dass aus dem Ruf „Wir sind das Volk“ heute ein inklusives „Wir sind alle das Volk“ geworden sei.
Die Aussage benennt eine erweiterte Gemeinschaft. Sie umfasst Menschen aus unterschiedlichen Regionen, Religionen und Herkunftsländern.
„Wir sind alle das Volk“: Zusammenwachsen durch Zuwanderung und Integration
Zuwanderung und lokale Integrationsangebote haben Vielfalt verstärkt. Öffentliche Debatten tragen dazu bei, Perspektiven aus Ost und West gleichberechtigt zu hören.
„Wir sind alle das Volk“
Ost‑West‑Erfahrungen: Brüche, Lohngefälle und offene Aufarbeitung
Viele Menschen in Ostdeutschland erlebten persönliche und berufliche Brüche. Qualifikationen verloren an Wert, ganze Jahrgänge wanderten ab.
Das fortbestehende Lohngefälle bleibt ein messbarer Hinweis auf strukturelle Ungleichheiten. Politik und Gesellschaft diskutieren längerfristige Maßnahmen.
Die Forderung nach Transparenz reicht bis zur Öffnung der Treuhand‑Akten. Offenheit kann Mythen korrigieren und Vertrauen stärken.
- Erweiterung des gesellschaftlichen „Wir“ durch Migration und regionale Vielfalt
- Langfristige Folgen: Lohngefälle, Abwanderung, entwertete Biografien
- Offene Aufarbeitung als Motor für Vertrauen und korrigierte Narrative
| Aspekt | Beobachtete Folgen | Handlungsempfehlung |
|---|---|---|
| Integration | Mehrsprachige Gemeinschaften, neue Vereine | Förderprogramme, lokale Partizipation stärken |
| Regionale Disparitäten | Abwanderung junger Menschen, Lohngefälle | Strukturförderung, Investitionen in Bildung und Arbeitsplätze |
| Öffentliche Aufarbeitung | Unsicherheit, Mythenbildung | Öffnung von Akten, transparente Debatten |
Kultur & Freizeit am 3. Oktober: Tipps für den Herbst
Das Herbstprogramm rund um den Feiertag verbindet historische Bildung mit Freizeitangeboten in Berlin und Brandenburg. Es bietet Angebote für unterschiedliche Interessen und Altersgruppen.

Tag der offenen Moschee
Islamische Religionsgemeinschaften öffnen bundesweit ihre Räume. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in Gemeindeleben und Austauschformate.
Ministergärten in Berlin
In den Ministergärten stehen traditionell sieben Landesvertretungen für Publikum offen. Die Häuser präsentieren Länderprofile und föderale Arbeit.
Berliner Mauer erleben
Geschichtsbewusste können an geführten Radtouren von der Bornholmer Straße bis zum Regierungsviertel teilnehmen.
Stadtführungen zeigen Originalschauplätze; Spaziergänge entlang des Grenzstreifens verbinden Erinnerung und Bewegung.
Feste, Märkte und urbane Kultur
Regionale Märkte wie der Regionalmarkt Uckermark und der Lausitzer Herbstmarkt bieten Produkte und Familienprogramme.
In Berlin finden Berliner Herbstrummel, Tag der Clubkultur und die Design Börse Berlin statt. Zusätzliche Naturangebote reichen bis zur Kranichwoche im Unteren Odertal.
„Die Vielfalt der Angebote ermöglicht es Menschen, Geschichte, Kultur und Freizeit zu kombinieren.“
| Angebot | Ort | Schwerpunkt |
|---|---|---|
| Offene Moscheen | bundesweit | Dialog, Gemeindeeinblick |
| Ministergärten | Berlin | Landesvertretungen, Ausstellungen |
| Mauer‑Touren | Bornholmer Str. → Regierungsviertel | Historische Bildung, Radtouren |
| Herbstmärkte & Feste | Berlin / Brandenburg | Regionale Produkte, Familien |
Hinweis: Diese kompakten Informationen erleichtern die Tagesplanung und verknüpfen kulturelle Bildung mit Freizeitaktivitäten am 3. Oktober.
Warum der 3. Oktober ein nationaler Feiertag wurde
Die Wahl des 3. Oktobers als gesetzlicher Feiertag folgte einer klaren rechtlichen und symbolischen Logik.
Im Einigungsvertrag wurde verbindlich festgelegt, dass der Beitrittstag am 3. Oktober 1990 liegt. Kapitel 1, Artikel 2 Absatz 2, bestimmt den Termin als gesetzlichen Feiertag. Diese Norm schuf eine eindeutige Rechtsgrundlage für nationale Gedenk- und Feierformate.
Historisch ersetzte dieses Datum den 17. Juni als nationalen Feiertag. Die Entscheidung spiegelte die neue staatsrechtliche Realität nach der wiedervereinigung wider. Der Beitrittstag wurde bewusst gewählt, weil er den vollendeten Einigungsakt dokumentiert.
Seit 1990 wird der Anlass jährlich begangen. Die Regelung erlaubt planbare Rituale, föderalen Wechsel der Gastgeber und öffentliche Beteiligung.
„Die klare Feiertagsnorm unterstützt Planung, Gedenken und gesellschaftliche Teilhabe.“
| Aspekt | Rechtsgrundlage | Praktische Folge |
|---|---|---|
| Datum | Kapitel 1, Art. 2 Abs. 2 Einigungsvertrag | Einheitliche nationale Erinnerung |
| Historischer Wechsel | Ersetzung des 17. Juni | Neuer nationaler Bezugspunkt |
| Institutionalisierung | Bundesratsvorsitz rotiert | Jährliche Ausrichtung durch wechselnde Gastgeber |
Weiterführende Fakten sind in der Übersicht zur Tag der Deutschen Einheit zusammengefasst.
Fazit
Aus zivilem Druck, rechtlicher Präzision und internationaler Zustimmung entstand ein verbindlicher nationaler Anlass. Die friedliche revolution ermöglichte freie Wahlen; der Einigungsvertrag fixierte den Beitritt zum 3. Oktober 1990.
Der Zwei‑plus‑Vier‑Vertrag beendete zudem die Vier‑Mächte‑Rechte und schuf außenpolitische Klarheit. Heute organisiert das föderale System Beflaggung, Festakt und Bürgerfest als wiederkehrende Praxis.
Die Erinnerung richtet sich an Menschen und an das politische Projekt der Wiedervereinigung. Offene Aufarbeitung von Brüchen, Lohngefälle und Treuhand‑Akten bleibt eine dauerhafte Aufgabe.
Symbole wie Schwarz‑Rot‑Gold und das nächtliche Hissen der Flagge unterstützen Identifikation. Dieser Leitfaden liefert Orientierung für künftige Jahre und erleichtert Planung rund um den tag.